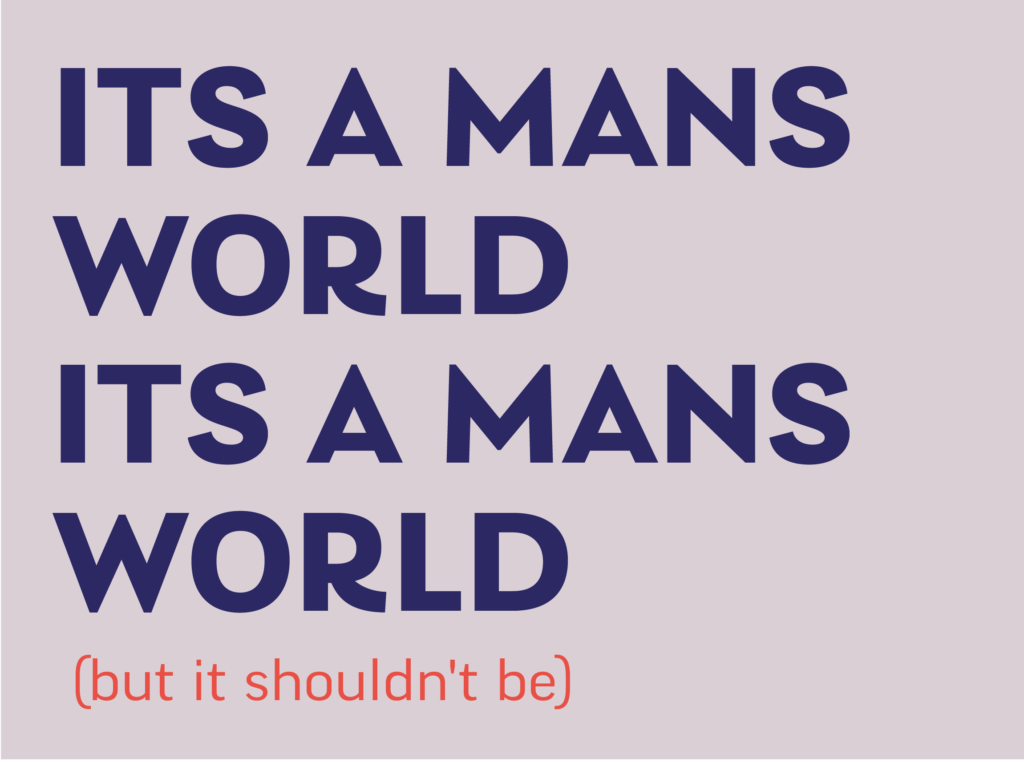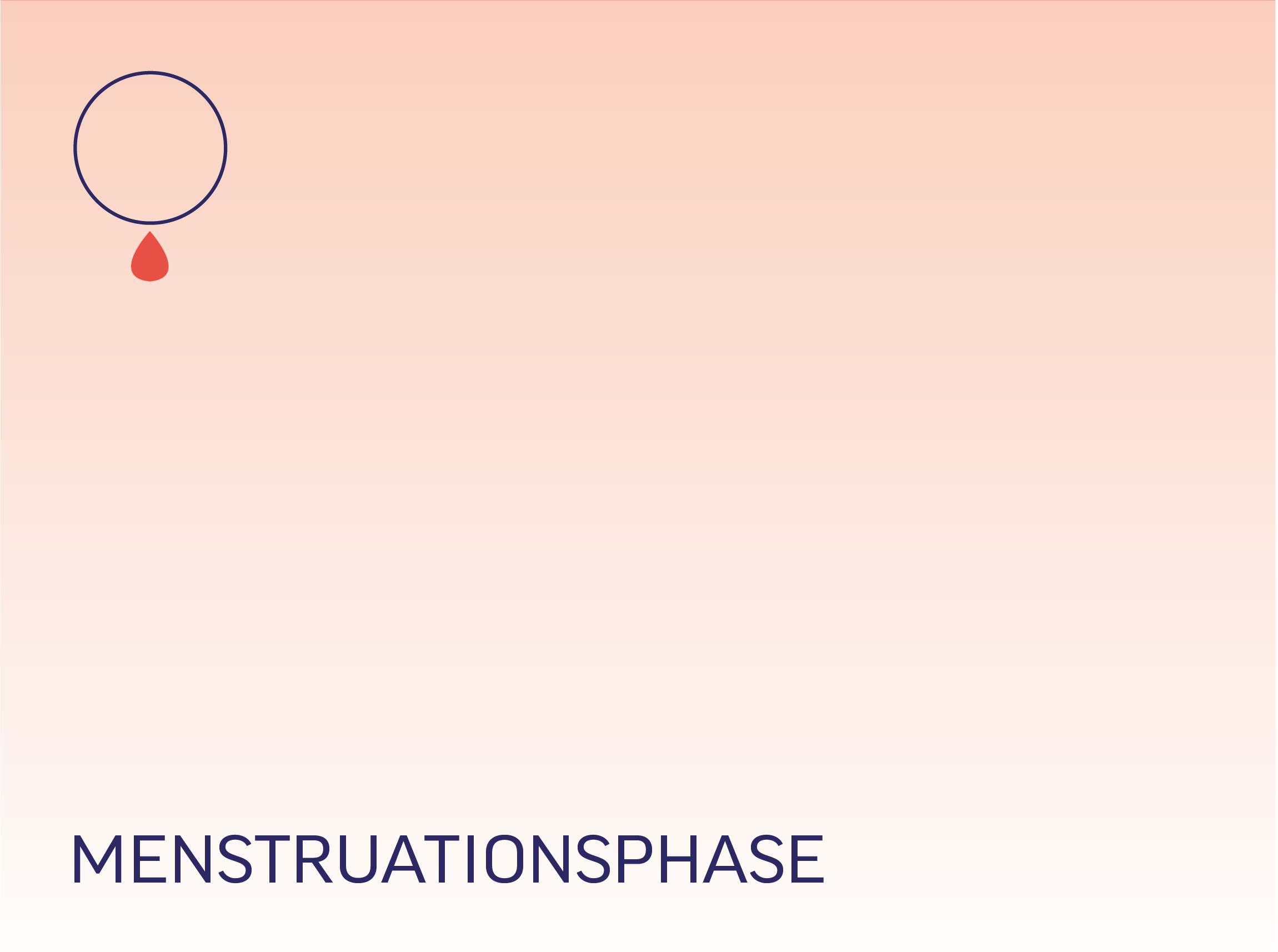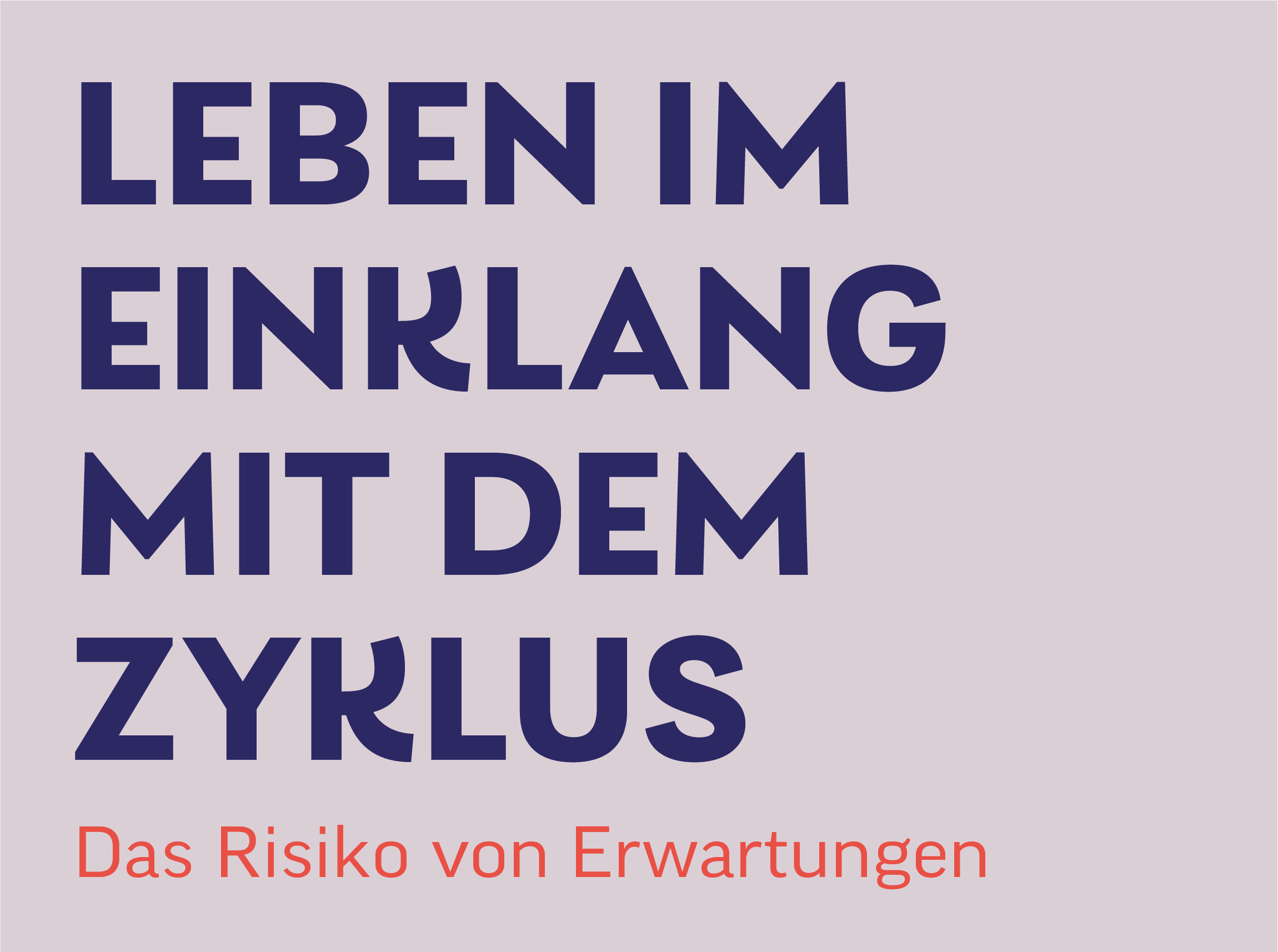„This is a man’s world, this is a man’s world
But it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl“
Diese Zeilen sang der amerikanische Künstler James Brown in seinem bekannten Lied von 1966 voller Inbrunst. Es sei eine männergemachte Welt. Männer bauten Autos und machten uns damit beweglich, sie waren verantwortlich für schlaue Erfindungen wie das elektrische Licht und selbst in den Geschichten der Bibel war es Noah, ein Mann, der angeblich die Menschheit durch den Bau seiner Arche vor dem sicheren Aussterben bewahrt hatte. Aber diese Welt wäre natürlich nichts ohne Frauen. Warum? Das verrät uns James Brown leider nicht. Sie sollen offenbar einfach da sein, damit die Männer, die Großes vollbringen, sich gut fühlen können und nicht verwildern oder verbittern. Zugegeben, das Lied ist vor über einem halben Jahrhundert erschienen, aber hat sich seitdem wirklich so viel geändert?
In Darstellungen wie diesen nimmt die Frau eine sehr passive Rolle ein und ihr autonomes Handeln ist stark beschränkt. Schon als kleines Mädchen habe ich immer von großen Erfindern, Künstlern oder Politikern gehört – überwiegend Männer. Damals habe ich mir nicht viel dabei gedacht; von klein auf hatte ich unbewusst internalisiert, dass Männer eben einfach fähiger wären als Frauen. Das hat dazu geführt, dass ich sehr lange ausschließlich zu Männern hochgeblickt habe bzw. so cool und schlau wie ein Mann sein wollte. Ganz ehrlich, es gab für mich zu jener Zeit aber auch kaum Frauen, die ich für mich als Vorbild wahrgenommen habe. Die meisten Frauen in den Medien wurden in erster Linie wegen ihrer Schönheit gefeiert und die Frauen in meinem persönlichen Umfeld waren alles andere als das, was ich sein wollte. Viele von ihnen waren Mütter und Hausfrauen und haben zugunsten ihrer Familie ihre eigenen Karrieren hinten angestellt. Auch in der Dynamik meiner Eltern konnte ich immer herauslesen, dass mein Vater stets der ist, der entscheidet und das letzte Wort hat. Meine Mutter sollte lediglich das machen, was er entschieden hat. Die Positionen waren klar verteilt – er war der Macher, sie die Folgsame. Und alles, was meine Mutter verkörperte, ihre wirklich wunderbaren Eigenschaften wie ihre liebevolle Art, ihre Hingabe, ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit, wurden von meinen Vater ignoriert oder abgewertet. So habe ich lange Zeit alles, was meine Mutter ausgemacht hat, was von der breiten Gesellschaft vielleicht allgemein als traditionell weibliche Eigenschaften definiert wird, abgelehnt. Ich wollte so tough und bestimmend wie mein Vater sein.
Zurück zum Anfang. Die Frage ist, können Männer wirklich mehr als Frauen oder aber hören wir einfach zu wenig über großartige Frauen, die etwas kleines oder großes zum Weltgeschehen beigetragen haben?
Das Sachbuch Invisible Women von Caroline Criado-Perez handelt von der Unsichtbarkeit von Frauen in der Gesellschaft. In vielen Bereichen von der Medizin bis über die Wirtschaft werden Frauen nicht genügend berücksichtigt oder sogar übersehen. Das Weltgeschehen ist überwiegend an männlichen Normen orientiert. Von der Forschung über die Politik bis hin zum Alltag werden die Bedürfnisse und Beiträge von Frauen häufig übersehen. Dies führt zum sogenannten Gender Data Gap. Der Gender Data Gap bezeichnet die unzureichende Erfassung von geschlechtsspezifischen Informationen und Daten in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel habe ich erfahren, dass Crash-Test-Dummies in simulierten Unfällen von der Größe und Gewicht einem Durchschnittsmann entsprechen, sodass die Sicherheitsmaßnahmen in Autos nicht optimal auf den weiblichen Körper abgestimmt sind, der nun einmal anatomische Unterschiede aufweist. Generell ist das Auto kein sicherer Ort für Frauen. Der Sicherheitsgurt ist für die weibliche Brust nicht ausgelegt. Auch in der Medizin lassen sich ähnliche Ungleichheiten beobachten. Bislang wurden die meisten Medikamente an Männern getestet, weil der weibliche Körper in vielen Belangen einfach zu komplex ist. Der biologische Zyklus wird als viel zu unberechenbar wahrgenommen, sodass man häufig auf Grund von Zeit und Geld lieber den vergleichsweise simpleren Mann als Testperson wählt. Dies hat zur Folge, dass viele Medikamente im weiblichen Körper anders wirken, und diese potentiell gefährlichen Unterschiede werden erst seit ein paar Jahren schrittweise aufgearbeitet und einbezogen.
Das Buch von Caroline Criado-Perez zeigt gut, dass es notwendig ist die Art und Weise zu überdenken, wie Daten aktuell erfasst und analysiert werden, um eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft zu schaffen.